
AGB-Recht: Anforderungen an das Aushandeln von Vertragsklauseln - Merkmale einer Individualvereinbarung
Es ist gefestigte Rechtsprechung, dass AGB-Klauseln immer dann vorliegen, wenn die Absicht besteht, sie nicht nur in einem einzigen Fall, sondern wiederholte Male zu verwenden; die Verwendung in drei Fällen reicht insoweit aus. Weiter ist es gefestigte Rechtsprechung, dass AGB-Klauseln wegen der sehr strengen richterlichen Inhaltskontrolle nicht mehr dazu dienen können, etwaige Risiken eines Vertrages in angemessener Weise zu begrenzen. AGB sind untauglich, um eine verlässliche Risikobegrenzung in einem Vertrag zu erreichen. Dafür bedarf es immer einer Individualvereinbarung.
Doch das ist leichter gesagt als getan. Denn der BGH hat in einem Urteil vom 22.11.2012 (Az.: VII ZR 222/12) sehr enge Grenzen aufgezeigt, weil nach § 305 Abs. 1 Satz 3 BGB nicht ein Verhandeln, sondern ein Aushandeln erforderlich ist. Dieses aber ist dadurch charakterisiert, dass derjenige, der die AGB in den Vertrag eingeführt hat, zunächst verpflichtet ist, den „gesetzesfremden Kerngehalt" der jeweiligen Klausel ernsthaft zur Disposition zu stellen, um dem anderen Vertragsteil die Gelegenheit zu geben, seinerseits von der seinen Interessen gemäßen Vertragsgestaltungsfreiheit Gebrauch zu machen. Folglich muss der andere Vertragsteil die „reale Möglichkeit" haben, den Inhalt der vorformulierten Vertragsbestimmung nach seinen eigenen Interessen zu gestalten. In der Regel führt dies dazu, dass nur solche Klauseln als ausgehandelt und damit als Individualabrede einzuordnen sind, die nach den Vorstellungen des Kunden tatsächlich abgeändert worden sind.
In dem nunmehr vom BGH entschiedenen Fall ging es darum, dass der Betreiber einer Müllverbrennungsanlage eine so genannte „bring or pay"-Klausel vorgesehen hatte. Der Lieferant war danach verpflichtet, jeweils pro Quartal eine bestimme Menge an Müll zu bringen, damit dieser verbrannt und damit entsorgt werden konnte. Wenn er aber zu wenig anlieferte, dann sollte er - nach Abschluss des Quartals - für jede Tonne Minderlieferung einen Betrag von ca. € 100,00 zahlen. Die Vertragsverhandlungen zogen sich lange hin. Teilweise wurden die AGB geändert. Doch in Bezug auf diese Klausel blieb der Entsorger hartnäckig; er bezeichnete die „bring or pay"-Klausel als „nicht verhandelbar". Punktum. Der Lieferant - juristisch beraten - gab schließlich klein bei.
Wegen der Mindermengen verlangte der Entsorger später einen „Schadensersatz" von rund € 700.000,00. Aber im Laufe des Gerichtsverfahrens wandte er ein, dass es sich bei dieser Klausel um eine unwirksame AGB handelte. Der BGH stimmte dem zu: Wenn nämlich der Verwender dem Lieferanten keine Möglichkeit einräumt, eine vorformulierte Klausel nach seinen Vorstellungen abzuändern, dann ist und bleibt es eine AGB. Ihre Unwirksamkeit leitete der BGH aus zwei Gesichtspunkten ab: Zum einen überwälzte der Entsorger mit dieser Klausel das gesamte Investitions- und Betreiberrisiko auf seinen Lieferanten. Zum anderen war er aber auch nicht in der Lage, einen entsprechenden Schaden nachzuweisen, der ihm konkret als Folge der Minderlieferungen durch den Lieferanten entstanden war. Dass das „Geschäftsmodell" der Müllverbrennungsanlage auf diesem „bring or pay"-Konzept beruhte, war demgegenüber irrelevant. Denn ein Kaufvertrag und der damit gekoppelte Müllverbrennungsvertrag basieren auf dem Konzept der Gegenseitigkeit und auch der Äquivalenz von Leistung und Gegenleistung beider Vertragsparteien.
Was folgt daraus? Wenn vorformulierte Vertragsbestimmungen in einen Vertrag eingeführt werden, dann muss der Verwender solcher AGB diese ernsthaft und uneingeschränkt zur Disposition stellen, weil nur so der andere Vertragsteil die Gelegenheit erhält, seinerseits von der grundgesetzlich geschützten Vertragsgestaltungsfreiheit Gebrauch zu machen. Das bedeutet, dass der Verwender anstelle der vorformulierten Klausel dem Lieferanten/Kunden eine Version anbieten muss, die dem gesetzlichen Vorbild der betreffenden Klausel entspricht. Das geht weit, ist aber gefestigte Judikatur. Beispiel: Bei einer Haftungsbegrenzungsklausel muss der Verwender dem anderen Vertragsteil anbieten, dass er anstelle der betreffenden Begrenzungsklausel eine Vertragsbestimmung anbietet, die entsprechend dem Gesetz gar keine Haftungsbegrenzung vorsieht, sondern eine unlimitierte Haftung für den angerichteten Schaden nach den §§ 249 ff. BGB, einschließlich des entgangenen Gewinns. Wenn der andere Vertragsteil dann dies nicht will, kann, sollte und muss eine Lösung angepeilt werden, die den gemeinsamen Interessen beider Parteien in Form einer Haftungshöchstgrenze entspricht.
Wenn aber der Verwender geltend macht, dass die Klausel schlicht „nicht verhandelbar" ist, dann sollte er jedenfalls an anderen Stellen des Vertrages ganz entschieden den Wünschen und Vorstellungen des anderen Vertragspartners entgegenkommen, um insoweit - per Saldo - eine Balance der beiderseitigen Interessen zu erreichen. Denn immer ist es so - das ist die Essenz der BGH-Urteile - dass beide Parteien in gleichrangiger Weise in der Lage sein müssen, ihre Vertragsgestaltungsfreiheit entsprechend ihren Interessen auszuüben. Die Vertragsabschlussfreiheit des Kunden/Lieferanten ist nämlich nur ein Teil der Vertragsfreiheit; sie reicht nicht aus, um die richterliche Inhaltskontrolle nach § 307 BGB auszuschalten.
Quintessenz: Hartes Verhandeln auf Basis wirksamer AGB ist überflüssig; hartes Verhandeln auf Basis unwirksamer AGB aber ist verhängnisvoll.
Prof. Dr. Friedrich Graf von Westphalen
2. Juli 2013
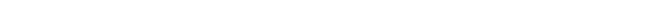

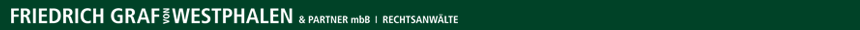


 Abonnieren Sie unseren Newsletter
Abonnieren Sie unseren Newsletter