Die EU-Kommission beabsichtigt seit 2008, eine „Europa-GmbH" (Societas Europaea Privata, SPE) einzuführen. Insbesondere wegen deutscher Vorbehalte ist das Projekt jedoch im Herbst 2011 ins Stocken geraten. Die Bundesrepublik hatte einen Richtlinienentwurf der Kommission zur Schaffung der SPE im Ministerrat blockiert. Hintergrund war die Sorge um eine Erosion der deutschen Arbeitnehmer-Mitbestimmung. Jetzt erwägt die EU-Kommission, die „Europa-GmbH" auch ohne deutsche Beteiligung einzuführen. EU-Binnenmarktkommissar Michel Barnier prüft derzeit Wege, das Vorhaben voranzubringen und zieht dabei auch die sogenannte „verstärkte Zusammenarbeit" in Betracht. Das Verfahren der verstärkten Zusammenarbeit erlaubt es einer Gruppe von Mitgliedsstaaten, gemeinsame Regeln einzuführen, ohne dass andere EU-Mitglieder daran mitwirken. Deutschland bliebe bei der Einführung der Europäischen Privatgesellschaft also außen vor.
Zum Hintergrund
Derzeit gründen deutsche Mittelständler, die im Ausland tätig sind, in der Regel in jedem Land eigene Tochtergesellschaften in der landestypischen Rechtsform. Das kostet Geld und behindert - nach Auffassung der EU-Kommission den grenzüberschreitenden Verkehr in der EU. Um den klein- und mittelständischen Unternehmen die grenzüberschreitende Tätigkeit zu erleichtern, hat die EU-Kommission 2008 beschlossen, eine neue Gesellschaftsform zu schaffen - die Societas Privata Europaea = SPE, auch „Europa-GmbH" genannt, die kleine Schwester der Societas Europaea, der Europa-AG. Kennzeichnend für die SPE ist, dass EU-weit ein einheitliches Regelungskonzept geschaffen werden soll. Eine SPE soll in jedem Land Europas den gleichen Regeln unterliegen - mit Ausnahme des Arbeits-, Steuer und Insolvenzrechts. Die innere Organisation soll im Wesentlichen von den Anteilseignern frei bestimmt werden können.
Streitstand
Das Europäische Parlament unterstützte den Vorschlag zur Schaffung der SPE massiv und forderte die Mitgliedstaaten in einer Entschließung vom 12.05.2011 zur Zustimmung auf. Nationale Interessen im Hinblick auf Sitz / Sitzverlegung, Mindestkapitalausstattung (im Raum stehenden Beträge zwischen 1,00 und 8.000,00 EUR), Arbeitnehmermitbestimmung und die Form der Anteilsübertragung (notarielle Beurkundung - ja/nein) haben bislang jedoch eine Einigung verhindert. Die (fast schon traditionellen) Bedenken Deutschlands gehen wie auch bei der Einführung der großen Schwester der SPE, der Europäischen Aktiengesellschaft (SE) und der grenzüberschreitenden Verschmelzungsrichtlinie dahin, dass mit der Einführung der SPE die im Vergleich zu den übrigen Mitgliedstaaten hohen Standards im Bereich der Arbeitnehmermitbestimmung umgangen werden könnten.
Wenn es zu einer Einigung ohne Deutschland kommt, hätte dies zur Folge, dass die SPE in etlichen Ländern der EU eingeführt würde, allerdings nicht in Deutschland. Diese (ausländische) SPE müsste aufgrund der Niederlassungsfreiheit von Deutschland anerkannt werden, was wiederum bedeuten könnte, dass deutsche Unternehmen eine SPE mit Sitz außerhalb Deutschlands als Rechtsform für ihre Aktivitäten im Ausland wählen. Kein gutes Zeichen für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Denn gerade dann würden sich die Bedenken der Bundesregierung realisieren, denn Mindestkapital, Arbeitnehmermitbestimmung und Form der Anteilsübertragung würde sich dann nach ausländischem Recht richten, auf das Deutschland keinen Einfluss hat. Aufgrund des Sitzes im Ausland wäre auch eher zu befürchten, dass deutsches Steuersubstrat reduziert wird. Es ist also im eigenen Interesse Deutschlands, an einer einheitlichen Lösung konstruktiv mitzuarbeiten und seine allzu kritische Sicht auf die SPE und z.T. irrationalen Befürchtungen zurückzustellen und sich dem Wettbewerb der Rechtsordnungen zu stellen. Die Ankündigung der EU-Kommission, die Europa-GmbH notfalls ohne Deutschland zu realisieren, sollte also Anlass für die deutsche Regierung sein, sich in der Sachdiskussion zu bewegen.
Dr. Barbara Mayer
6. September 2012
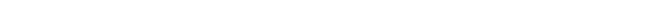




 Abonnieren Sie unseren Newsletter
Abonnieren Sie unseren Newsletter